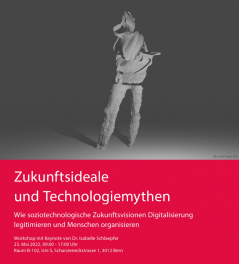Workshop
Workshop mit Keynote von Dr. Isabelle Schlaepfer im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Kritische Perspektiven auf Digitalisierung» des Vizerektorats Qualität der Universität Bern.
Digitalisierungsprozesse finden in praktisch allen Lebens- und Themenbereichen statt, seien es Self-Check-out Terminals im Supermarkt, biometrische Identifikationssysteme im Flüchtlingslager oder digitalisierte Gesundheitsdossiers: All diese Technologien werden als Lösungen zu Problemen oder zumindest (finanziellen) Optimierungen verstanden und sind mit grossen Hoffnungen, Zukunftsvorstellungen und Zuversicht beladen – sie sollen Prozesse erleichtern, Effizienz und Effektivität steigern, und besonders «kunden- und anwenderfreundlich» sein.
Diese vermeintlichen Errungenschaften sind aber nicht neutral, wie oft angenommen wird, sondern haben (häufig unvorhergesehene) ausgrenzende, diskriminierende und Ungleichheit stiftende Wirkungen: Das Verkaufspersonal im Supermarkt wird allenfalls obsolet, Biometrik erfasst gewisse Menschengruppen falsch oder erkennt diese nicht richtig, private Gesundheitsdaten werden möglicherweise ohne volles Einverständnis an Dritte weitergegeben. Diese Beispiele zeigen, dass Digitalisierungsprozesse in erster Linie soziale Prozesse sind, die durch machtpolitische Spannungen und soziotechnische Ungleichheitsverhältnisse strukturiert werden. Zu fragen, welche – und wessen – Zukunftsvisionen und Hoffnungen sich etablieren, die gewisse Technologien erst legitimieren und ‹gesellschaftsfähig› machen, kann uns helfen, sich durch Digitalisierung verändernde und veränderte Gesellschaftsstrukturen, und deren Auswirkungen auf den Menschen, besser zu verstehen.
In dieser Veranstaltung setzen wir uns intensiv mit den Zukunftsidealen und Technologiemythen von Digitalisierungstechnologien auseinander. Dabei stützen wir uns auf das Konzept der ‹sociotechnical imaginaries›. Sociotechnical imaginaries sind definiert als: «Collectively held, institutionally stabilized, and publicly performed visions of desirable futures, animated by shared understandings of forms of social life and social order attainable through, and supportive of, advances in science and technology» (Jasanoff and Kim 2015, 4). Dahinter verbirgt sich die Idee der Ko-Produktion von Technologien und Gesellschaft: In jeder Technologie manifestieren sich explizite und implizite Vorstellungen einer imaginierten Gesellschaft, womit Diskriminierungen und Ausdrücke sozialer Ungleichheit Hand geboten wird. Gleichzeitig treiben erst bestimmte Zukunftsvisionen, Sehnsüchte und Mythen technologische Innovationen an.
Das Ziel der Veranstaltung ist es einerseits, ‹sociotechnical imaginaries› und ihre Wirksamkeit anhand bestimmter Fallbeispiele zu verstehen, und andererseits nach den konkreten Legitimierungspraktiken und -mechanismen zu fragen, welche Digitalisierungsprozesse und Ausgrenzungen stabilisieren.
Teilnehmende sind eingeladen, sich während dieser Veranstaltung mit ihrem eigenen Forschungsmaterial aus der Perspektive der ‹sociotechnical imaginaries› in Gruppen und im Plenum auseinanderzusetzen. Ziel ist es, gemeinsam ein konzeptuelles Verständnis zu erarbeiten, methodische und konzeptionelle Herangehensweisen abzuschätzen, und Herausforderungen aufzudecken – sowohl beim Forschungsmaterial, also auch beim Konzept selbst.
Provisorischer Ablauf des Workshops am 23. Mai 2022
09:00 - 10:00 Uhr
Begrüssung von Prof. Dr. Silvia Schroer und anschliessende Keynote von Dr. Isabelle Schlaepfer: «Einführung in die sociotechnical imaginaries»
10:00 - 12:00 Uhr
Gemeinsame Diskussion und Gruppenarbeiten zum konzeptio- nellen Verständnis der ‹sociotechnical imaginaries›
12:00 - 13:30 Uhr
Gemeinsames Mittagessen
13:30 - 15:15 Uhr
Gruppenarbeiten und erneuter Austausch
15:30 - 16:00 Uhr
Input von Dr. Isabelle Schlaepfer: «Herausforderungen und Kritik am Konzept der sociotechnical imaginaries»
16:00 - 17:00 Uhr
Gruppenarbeiten und Abschluss der Veranstaltung
Der Anlass wird vor Ort an der Universität Bern durchgeführt, die Möglichkeit einer Online-Teilnahme (mit Einschränkungen in den Gruppenarbeitsphasen) ist vorgesehen. Der Workshop findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Vizerektorats Qualität «Kritische Perspektiven auf Digitalisierung» statt und richtet sich explizit an Teilnehmende aus einer Vielzahl von Fachrichtungen (Sozial-, Geisteswissenschaften, aber auch Naturwissenschaften, Kunst- und Designwissenschaften).
Interessierte an Keynote und Workshop melden sich bitte mit einem Beschrieb der eigenen Arbeit (nicht länger als 250 Wörter) bis zum 13. April 2022 bei Anna Janka (anna.janka@unibe.ch). Wir begrüssen auch Anmeldungen nur für die Teilnahme an der Keynote.
Organisiert von
Digital Humanities (Universität Bern) / Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung (Universität Bern)
Veranstaltungsort
Universität Bern, Raum B-102, Uni S
Schanzeneckstrasse 1
3012
Bern
Kosten
CHF 0.00