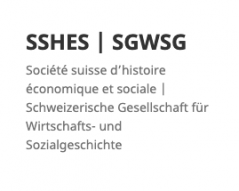Call for papers
Jahrestagung SGWSG
9. September 2022, Universität Fribourg
Politische Macht wird in allen Gesellschaften öffentlich inszeniert. Durch Rituale, Symbole, Bilder und andere öffentliche Formen der Inszenierung werden Machtordnungen legitimiert und soziale Hierarchien dadurch stabilisiert. Die Formen derartiger Repräsentationen sowie die Deutungsmuster, mit denen politische Machtverhältnisse und Entscheidungsfindungen sinnhaft und durchsetzbar gemacht werden, variieren jedoch je nach historischem Kontext. Auch wandeln sich die Kommunikations- und Erfahrungsräume wie auch die strukturellen und sozialen Kontexte, in denen Handeln und Sprechen des Politischen stattfinden. Als gemeinsamer Nenner liegt ein Verständnis von Politik als ein Modus der Aushandlung und der Kommunikation vor, deren «Codes auf die Herstellung kollektiv bindender Entscheidungen» (Thomas Mergel) ausgerichtet sind.
Ausgehend von aktuellen Debatten um Populismus als «Schatten der repräsentativen Demokratie» (Jan-Werner Müller) und die scheinbare Krise der Demokratie als politische Ordnung fragt die SGWSG-Jahrestagung 2022 danach, wie Macht und Herrschaft in der Geschichte inszeniert, legitimiert und herausgefordert, und wie Interessensziele und Partizipationsansprüche artikuliert und eingefordert werden. Diese Fragen sollen epochenübergreifend thematisiert werden. Beiträge aus der Zeitgeschichte und Geschichte der Neuzeit sollen dabei in einen Dialog treten mit jenen der mittelalterlichen und antiken Geschichte.
Die SGWSG-Jahrestagung möchte zum einen an jüngere Debatten um eine kulturhistorisch ausgerichtete Politikgeschichte anschliessen, die in der Geschichtsforschung eine Rückkehr des Politischen eingeläutet haben. Das wandelnde Verständnis von der Politikgeschichte ist nicht zuletzt von der Entstaatlichung des Politikbegriffs, der Betonung transnationaler Perspektiven, der Abwendung von (männlichen) Machtsubjekten und dem Einbezug marginalisierter und diskriminierter Gruppen begleitet. Zum anderen soll die Tagung eine geschichtswissenschaftliche Intervention in Forschungsdebatten darstellen, die in Nachbardisziplinen wie Politikwissenschaft, politische Soziologie, Sozialanthropologie und Kunstgeschichte stattfinden. Insbesondere in Teilen der Politikwissenschaft, die in der Schweiz lange Zeit in regem Austausch mit der Geschichtsforschung stand, ist eine methodische Neuorientierung und eine Enthistorisierung zu beobachten. Die Tagung soll dieses Verhältnis neu überdenken und nach gemeinsamen Untersuchungsgegenständen, Konzepten, theoretischen Prämissen und methodischen Zugängen fragen.
Im Zentrum der Tagung stehen drei Leitfragen: Erstens soll der Frage nachgegangen werden, wie das Politische in bestimmten Epochen und historischen Kontexten vorgestellt, definiert und praktiziert wurde. Welche Akteur:innen versuchten mit welchen Mitteln, Strategien und Zielen den Denk- und Handlungsrahmen des Politischen festzulegen? Welche Aspekte des sozialen Lebens und welche Teile der Bevölkerung galten dabei als Teile der res publica und communitas und welche wurden davon ausgeklammert? Welche geschlechtsnormativen Markierungen dienten der Stabilisierung politischer Herrschaftspraxis und wie wurden sie herausgefordert? Welche rassifizierenden und ethnisierenden Zuordnungskategorien und Logiken kamen in Auseinandersetzungen um Teilhabe am Politischen zum Tragen? Welche gesellschaftlichen Gruppen nutzten welche politischen Räume und Mittel, um ihre Vorstellungen und Forderungen einzubringen und sich gegen herrschende Machtverhältnisse aufzulehnen? Welche politischen Entscheide, Hierarchien und Machtordnungen waren besonders legitimationsbedürftig und welche nicht? Welches Verhältnis herrschte zwischen weltlicher und religiöser Macht bzw. politischer und wirtschaftlicher Macht? Welche politischen Ordnungsmodelle wurden breit und öffentlich diskutiert und welche gesellschaftlichen Kreise – etwa religiöse Zirkel, Expertengremien, Intellektuelle, Interessengruppen, soziale Bewegungen, ausgegrenzte Gruppen usw. – beteiligten sich an diesen Aushandlungen?
Zweitens soll danach gefragt werden, ob das Politische in der Sattelzeit eine Umdeutung erfahren hat oder ob es allenfalls Kontinuitäten in der Art gibt, wie politische Macht in verschiedenen Epochen und unterschiedlichen geographischen Räumen inszeniert, legitimiert und herausgefordert wurde. Die Politikgeschichte war lange Zeit stark durch Ansichten geprägt, wie sie etwa Jürgen Habermas vorgetragen hatte, wonach sich politische Fragen ab dem 18. Jahrhundert primär in einer durch Ideen der Aufklärung geprägten bürgerlichen Öffentlichkeit verhandelt würden. Es kamen politikhistorisch zentrale Konzepte wie öffentliche Meinung, Partizipation und Propaganda auf, deren Geschichtlichkeit und analytische Reichweite seither immer wieder debattiert und in Frage gestellt werden.
Drittens geben in jüngster Zeit warnende Stimmen zu bedenken, dass Demokratisierung und kritische Aushandlung gesellschaftlicher Konflikte auch wieder rückgängig gemacht werden könnte, etwa durch zunehmende soziale und ökonomische Ungleichheit, anhaltende geschlechtsspezifische und rassistische Diskriminierung wie auch das Aufkommen neuer Medienöffentlichkeiten in der Form von sozialen Medien. Mit solchen sozialen Plattformen beispielsweise würden neue politische Kommunikations- und Handlungsräume entstehen, deren Funktionsweise und Logiken durch globale Unternehmen bestimmt werden, die sich politischer und demokratischer Aushandlung und Verantwortbarkeit entziehen. Von vielen wird dies als ein weiterer Schritt in Richtung einer Privatisierung politischer Macht sowie einer Etablierung neofeudaler Verhältnisse gesehen (Immanuel Wallerstein, Joel Kotkin). Derartige zeitgenössische Diagnosen sollen dazu anstossen, darüber nachzudenken, ob es bestimmte Aspekte des Politischen gibt, die für Gesellschaften in verschiedenen Epochen und geographischen Räumen konstitutiv sind bzw. wann und wo lassen sich allenfalls Zäsuren feststellen lassen und wie diese zu erklären sind.
In konzeptioneller und inhaltlicher Hinsicht können sich Beiträge auf verschiedene Untersuchungsebenen, Themen und Quellengattungen beziehen: von Ikonographie, Ritual, Performanz und symbolischen Praktiken über Monumente, Erinnerungsstätte, Geldstücke sowie Zeremonien, Huldigungen, Theaterstücke oder Kleiderordnungen bis hin zu verschiedenen Arten von Propagandamitteln und politischen Debatten.
Beiträge
Wir erbitten Vorschläge für Beiträge aus allen Epochen der Geschichtswissenschaft (Antike, Mittelalter, Neuzeit, Zeitgeschichte), sowie aus der Soziologie, Politologie, Sozialanthropologie, Kunstgeschichte, den Area Studies oder Religionswissenschaften.
Möglich sind Einzeleingaben aber auch Vorschläge für Panels mit drei bis vier Beiträgen (die Referierenden müssen von verschiedenen Universitäten stammen und möglichst auch verschiedene Epochen und/oder geographische Räume abdecken)
Eingabe der Abstracts (ca. 2000 Zeichen für Einzeleingaben; ca. 6000 Zeichen für Paneleingaben) bis 1. März 2022 an:
thalia.brero@unine.ch
christof.dejung@hist.unibe.ch
damir.skenderovic@unifr.ch
Der Entscheid über Annahme oder Ablehnung des Vorschlags wird bis Ende März 2022 mitgeteilt.
Organisiert von
Organisation: Thalia Brero (UNINE), Christof Dejung (UNIBE), Damir Skenderovic (UNIFR)
Zusätzliche Informationen