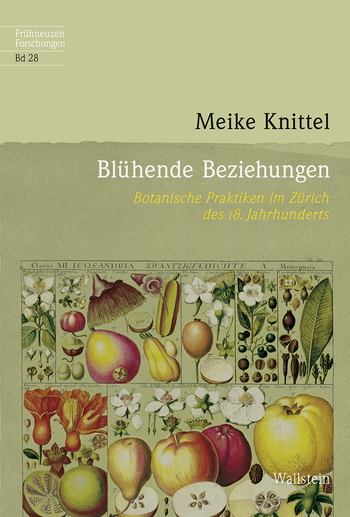Meike Knittel hat ein Buch über die botanischen Praktiken im Zürich des 18. Jahrhunderts geschrieben. Am Beispiel Zürichs untersucht sie, wie Botaniker abseits höfischer, universitärer und kolonialer Zentren arbeiteten, und beleuchtet die Bedingungen für das Aufblühen der vormodernen Pflanzenkunde. Johannes Gessner, der 1746 zusammen mit anderen naturkundlich Interessierten die Naturforschende Gesellschaft in Zürich gründete, deren Herbarium pflegte und sich um die Einrichtung eines botanischen Gartens in der Limmatstadt bemühte, dient als zentrale Bezugsfigur, um aufzuzeigen, wie sich Zürich zu einem Knotenpunkt in den transnationalen botanischen Netzwerken des 18. Jahrhunderts entwickelte.
Dieses Buch sei eine «thematisch überaus breite, wissenschaftlich fundierte und aufschlussreiche Studie», die einen wichtigen Beitrag zur historischen Pflanzenforschung darstelle, schreibt Jana Kittelmann in ihrer Rezension. Meike Knittels Ansatz sei «reizvoll und originell», die Quellenarbeit «umfangreich und intensiv» und die Erkenntnisse zahlreich. In ihrer Studie habe sie «systematisch und umfassend ein bislang nur wenig erforschtes, aber bedeutsames Kapitel der Botanik- und Pflanzengeschichte des 18. Jahrhunderts erschlossen. Ergänzt durch wunderschöne und klug ausgewählte Abbildungen von Pflanzen, Herbarbelegen (…), Tafeln, Mitgliedsurkunden, Plänen für Gewächshäuser und vielem mehr wird die Lektüre des Buches zu einem Leseerlebnis ersten Ranges.»
Die Rezension ist frei und online auf infoclio.ch und HSozKult verfügbar, ebenso das ganze Buch auf der Website des Wallstein Verlags.
Jana Kittelmann, Rezension zu: Knittel, Meike: Blühende Beziehungen. Botanische Praktiken im Zürich des 18. Jahrhunderts, Göttingen 2024, in: infoclio.ch, 27.3.2025, <https://www.infoclio.ch/de/rez?rid=150238>.